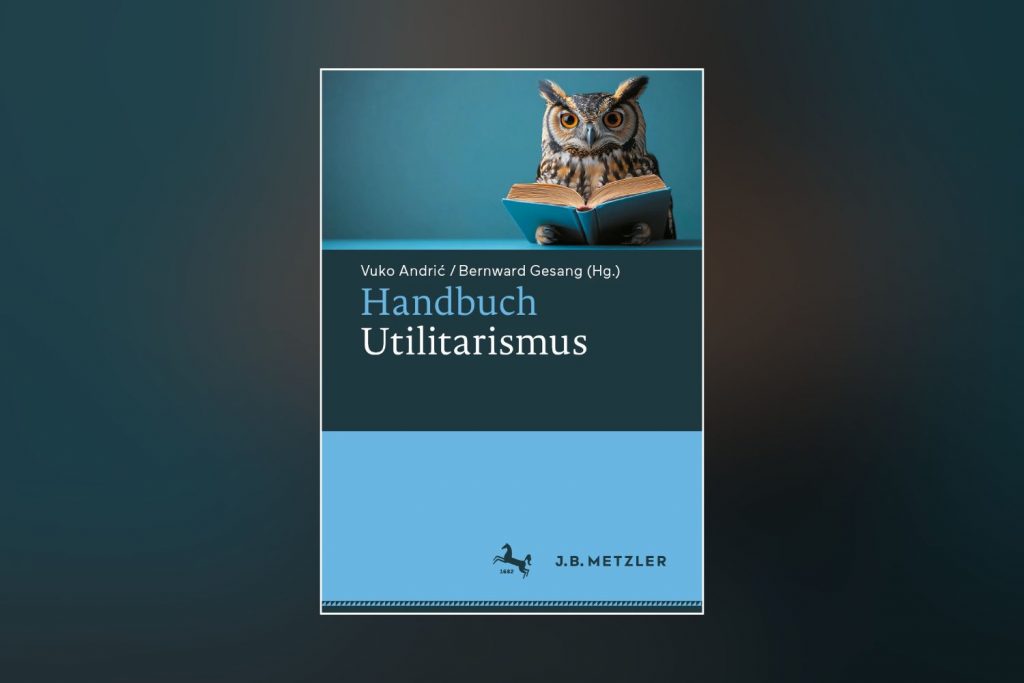Birnbacher betont, dass es sich bei Freiverantwortlichkeit um ein sogenanntes thick concept handelt, das sowohl deskriptive als auch normative Komponenten vereint. Besonderes Augenmerk legt er auf die Frage, wie sich diese Kriterien im Falle psychischer Erkrankungen anwenden lassen.
Birnbacher zeigt auf, dass eine psychische Krankheit die Freiverantwortlichkeit nicht pauschal ausschließt. Viele psychische Störungen verlaufen phasenhaft, und in „lichten Augenblicken“ kann Einwilligungs- und Entscheidungsfähigkeit wieder vorhanden sein: „Entscheidend ist das Ausmaß, in dem sie fähig sind, unter Bezug auf die Erfahrungen, die sie mit ihrer Krankheit gemacht haben, und auf der Grundlage ihrer Überzeugungen und Einstellungen zu einem wohlerwogenen Urteil darüber zu kommen, wie weit sie die vor ihnen liegende Wegstrecke gehen möchten und wie weit nicht.“
Die derzeitigen Verfahren zur Feststellung von Freiverantwortlichkeit seien bislang jedoch unzureichend. Sie lassen viele Fragen offen und schaffen Unsicherheiten sowohl für Ärztinnen und Ärzte als auch für Juristinnen und Juristen. Es bedarf daher verbindlicher fachlicher Leitlinien, die einen Rest an Augenmaß und individueller Urteilskraft nicht ersetzen können: „Weder das Recht noch die leitliniengebenden Instanzen können medizinische Diagnosen vollständig in Normen fassen. Insofern wird das Recht gut daran tun, sich weitgehend auf Verfahrensanforderungen zu beschränken.“
Die aktuelle Ausgabe der ZfMER ist online frei zugänglich: https://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=70852&elem=3629754