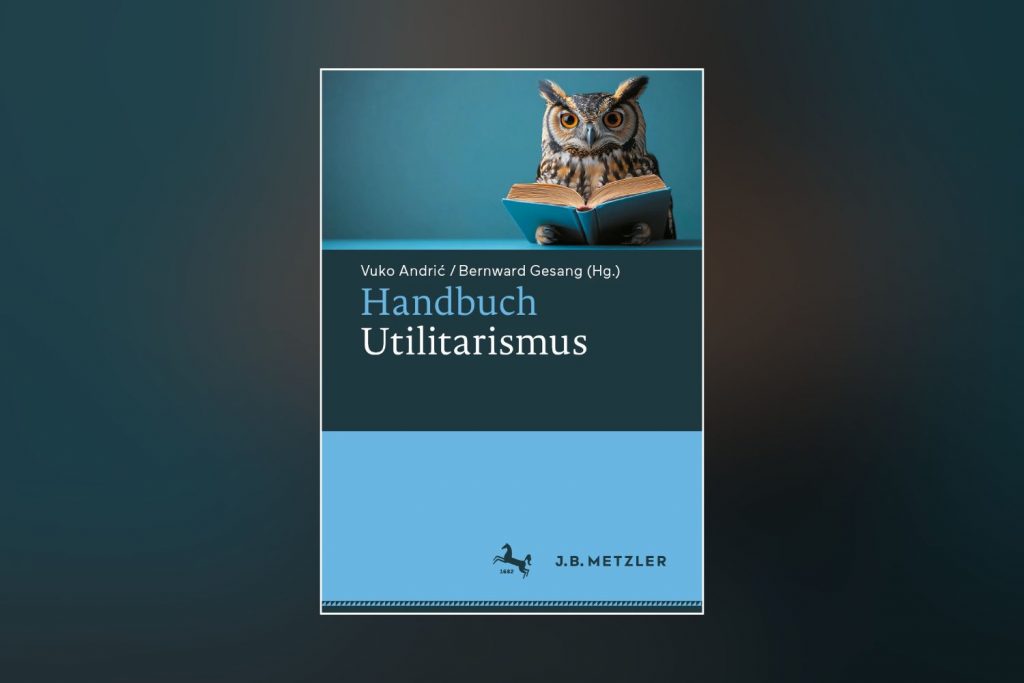(Si deus unde malum?)
1. Ausgangspunkt
Menschen erleben die Welt als gegensätzlich, als Quelle des Schmerzes einerseits und der Freude andererseits, als negativ und positiv, als gut und böse.
Auf der einen Seite gibt es das Naturschöne, das Kunstschöne, die Schönheit mancher Beziehungen zwischen Menschen sowie dieser zu anderen Lebewesen oder zur Natur. Es gibt Verständnis, menschliche Würde und Erhabenheit.
Auf der anderen Seite existieren natürliche und moralische Katastrophen, also Dinge wie Vulkanausbrüche, Kriege, Krankheiten, Tod, Hass, Vernichtungslager oder Erdbeben. Arthur Schopenhauer buchstabierte „Welt“ so: Weh, Elend, Leid, Tod, womit er nicht nur in prägnanter Weise seine eigene pessimistische Sicht der Dinge zusammenfasste, sondern auch ein prophetisches Wort sprach. Denn auf das 19. Jahrhundert dürfte sein düsteres Alphabet noch in geringerem Maße zugetroffen haben als auf die darauffolgenden, mit den Erfahrungen zweier Weltkriege und den Bedrohungen, die sich wie ein schwarzes Gewölk über unsere Köpfe zusammenbrauen.
Richtete man den Blick über das Diesseits hinaus und fragte nach einem möglichen Schöpfer des Ganzen, so lägen angesichts des Soseins der Welt mehrere Alternativen nahe: Gott ist sowohl gut als auch böse, oder: Gott ist moralisch indifferent, schuf zwar die Welt, zog sich dann aber wieder behaglich auf sich selbst zurück und lässt die Welt einfach dahintreiben, oder: Es gibt viele Götter, gute und böse, die um die Macht ringen, oder: Das Universum ist ein Produkt des Zufalls und nimmt ohne Weltenlenker seinen Lauf.
Trotz der drängenden Frage, wie das folgende Weltbild mit der Wirklichkeit vereinbar sein könnte, vertreten Christen und Muslime, zumindest in den europäischen Hochkirchen, ein anderes, sehr anspruchsvolles Gottesbild. Ihrer Meinung nach verkörpert der Höchste alle positiven Eigenschaften in höchstem Maße. Gott ist für sie das summum bonum, das „höchste Gut“, oder das ens perfectissimum, das „vollkommenste Sein“. Konkret ist Gott in diesen religiösen Traditionen allmächtig, allgütig, gerecht und barmherzig.
2. Attraktivität des traditionellen Gottesbildes
Warum seit Jahrtausenden trotz anscheinender Unverträglichkeit mit der Wirklichkeit an diesem positiven Gottesbild festgehalten wird, hat zumindest vier Gründe:
1. Ein solcher, sittlich vollkommener Gott besitzt moralische Autorität. Folglich ist es vernünftig, dessen Gebote und Anordnungen zu befolgen, wodurch sich auch der Streit um moralische Werte erübrigt. Es ginge dann nur noch um das richtige Verstehen der Worte Gottes. Sollte allerdings nicht gezeigt werden können, dass dieser gut und gerecht ist, so wird es moralisch höchst bedenklich, dessen Gebote blind zu befolgen.
2. Ein gütiger und gerechter Gott ist vertrauenswürdig. Man kann mit Ihm einen Dialog führen, sich an Ihn wenden, wenn man verzweifelt ist, Ihn um Rat fragen und Ihm das Intimste anvertrauen, Ihn manchmal sogar zu einem Tun ermuntern, also Seinen Willen zu beeinflussen suchen. Alles das, was als „Vertrauensbeziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf“ oder einfach als „beten“ verstanden wird, bekommt so einen nachvollziehbaren Sinn.
3. Wäre der Schöpfer, wie behauptet, sittlich vollkommen und allmächtig, so könnte in begründeter Weise geschlossen werden, dass alle Leiden der Welt gerechtfertigt seien, da hinter allem Geschehen ein wohlwollender Plan stünde. Wenn also ein vollkommenes Schöpferwesen existiert, so folgt daraus – wie Leibniz in seiner Theodizee immer wieder betonte – die Sinnhaftigkeit allen Leids.
4. Schließlich zur vielleicht größten Attraktivität des traditionellen Gottesbildes: Ein ethisch vollkommenes Wesen wäre Garant für eine ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits. Das sittliche Gefühl nimmt besonderen Anstoß an der Ungerechtigkeit des Weltenlaufs mit seiner mangelnden Entsprechung von Verdienst und Lebenssituation. Aber, so heißt es nun, der Allmächtige lässt zwar die irdische Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen, aber einmal wird er die Spreu vom Weizen trennen. Die Verkündigung, dass es den Mühseligen und Beladenen, den Verdammten dieser Erde einmal besser gehen werde, wird wohl kaum jemanden völlig kalt lassen. Aber diese Hoffnung setzt zumindest voraus, dass Gott selbst gütig, gerecht, mächtig, wissend und wohlwollend ist – also gerade so, wie zumindest in großen Teilen des Christentums und des Islams behauptet wird: Aufgrund seiner Weisheit hat Er die beste Welt erkannt, aufgrund Seiner Güte hat Er sie gewählt und aufgrund seiner Macht hat Gott sie geschaffen.
Das große Problem dieses positiven Gottesbildes ist, wie bereits mehrfach angedeutet, die Verträglichkeit mit der ambivalenten Wirklichkeit. Dank seiner Attraktivität haben jedoch zahlreiche Denker zu zeigen versucht, dass diese Welt des Leides und der apokalyptischen Ängste dennoch die Schöpfung eines allmächtigen und allgütigen Gottes sei. Viele Philosophen haben mit dieser Frage gerungen, und es gibt wohl keinen Theologen, den das Problem „Warum lässt der Gütige so viel Leid zu?“ nicht bedrängt hätte.
3. Präzisierung des Problems
Das Problem der Rechtfertigung der Güte und Barmherzigkeit Gottes angesichts der Leiden in einer von Ihm abhängigen Welt kann nun in dieser Weise präzisiert werden: Fraglich ist, ob die folgenden vier Behauptungen miteinander verträglich sind oder nicht. Diese lauten:
I. Es gibt einen Gott, ein personales Höchstes Wesen, den Schöpfer dieser Welt.
II. (Dieser) Gott ist allmächtig, allgütig und allwissend. Er ist das vollkommenste Sein.
III. Etwas, das selbst gut ist, würde etwas anderes, das schlecht oder böse ist, nach Möglichkeit verhindern oder beseitigen.
IV. Es gibt in dieser Welt eine Vielzahl von Leiden.
Die meisten Christen und Muslime teilen, wie schon gesagt, dieses positive Gottesbild. Über die folgende nähere Bestimmung der göttlichen Eigenschaften dürften sie ebenfalls ohne große Probleme sich verständigen können:
Allmacht: Macht ist die Fähigkeit, nach eigenem Gutdünken einen Zustand belassen oder verändern zu können. Ein Wesen besitzt Macht, wenn es diese Fähigkeit hat, und ein Wesen besitzt Allmacht (oder: „ist allmächtig“), wenn es alles schaffen oder verändern kann, was es will. Der Allmächtige kann es regnen lassen, wenn es Ihm beliebt, oder die Erde zu einem Würfel formen, wenn er dies möchte.
Allwissenheit: Jemand ist allwissend, wenn er alles weiß, was gewusst werden kann, also: was geschehen ist, was geschieht, was geschehen wird und was geschehen könnte. Die Eigenschaft der Allwissenheit ist bereits in jener der Allmacht enthalten, denn ein Wesen, dem es an Wissen fehlt, fehlt es auch an Macht. Ist es hingegen allmächtig, so ist es auch allwissend.
Allgüte: Ein Wesen, das gut ist, will und tut Dinge, die gut sind; und ein solches, das vollkommen gut ist, will und tut immer nur Dinge, die gut sind. Gibt es auch viel Streit darüber, was „gut“ genau bedeuten mag, so dürften die allermeisten folgender Minimaldefinition zustimmen können: Eine Handlung ist gut, wenn sie dem Wohlwollen entspringt und dem Gemeinwohl dient. Der Allgütige setzt nur Handlungen dieser Art.
Alle Versuche nun, die zahllosen Leiden der Welt zu rechtfertigen und damit Gottes Güte zu erweisen, heißen zumindest seit Leibniz Theodizeen, von gr. theos, „Gott“ und gr. dike, „Gerechtigkeit“. Eine Theodizee ist also, um dies nochmals zu wiederholen, „die Rechtfertigung der Güte und Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids in einer von Ihm abhängigen Welt“.
Die meisten Gläubigen nehmen nun an, dass eine solche Theodizee gelinge, somit gezeigt werden könne, dass die oben angeführten Prämissen I‑IV miteinander verträglich sind. Der Einfachheit halber seien sie „Theisten“ genannt, während jene, die die Vereinbarkeit der Prämissen bezweifeln, „Skeptiker“ heißen mögen. Diese meinen also, dass Theisten, wollen sie keinem widersprüchlichen Weltbild anhängen, zumindest eine der vier Behauptungen preisgeben müssen.
Schon im 18. Jahrhundert, manchmal auch „Jahrhundert der Theodizeen“ genannt, nahm dieses Problem unter Skeptikern beinahe den Rang eines Gegenbeweises zu den klassischen Gottesbeweisen ein, wobei folgendermaßen argumentiert wurde:
a. Wenn der christliche Gott existiert, so weiß er aufgrund seiner Allwissenheit um die Existenz von Übeln. b. Aufgrund seiner Allmacht kann er sie verhindern. c. Aus der Existenz eines gütigen Gottes folgt also die Nicht-Existenz von Übeln und aus der Existenz von Übeln die Nicht-Existenz eines gütigen Gottes.
Fazit: Es gibt Übel. Also existiert der gütige, christliche Gott nicht.
Obwohl der erste Anschein eher für die skeptische Position spricht, ist nicht unmittelbar einzusehen, ob die Prämissen I‑IV miteinander verträglich sind oder nicht. Wäre dem nicht so, hätten wohl kaum unzählige Menschen zumindest seit Hiob mit dieser Frage gerungen. Sollte jedoch das Scheitern der Theodizeen gezeigt werden, so spräche dies dafür, dass es einen Gott gibt, der auch negative Eigenschaften in sich vereint oder dass es viele, gute und böse Götter gibt, die um das Schicksal der Menschen ringen – oder dass die Welt einfach das Produkt des Zufalls oder eines Schöpfergottes ist, der sich – nach getaner Arbeit – wieder ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Aber für jede dieser Möglichkeiten gilt, dass die Vorstellung einer ausgleichenden Gerechtigkeit im Jenseits aufgegeben werden müsste.
Die Meinung, die Kant zu diesem Problem hatte, geht prägnant aus dem Titel seines im Jahre 1791 in der Berlinischen Monatsschrift veröffentlichten Textes hervor: Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee.
4. Gerechtfertigtes und ungerechtfertigtes Leid
Nachdem die grundsätzliche Attraktivität des traditionellen Gottesbildes sowie seine entscheidende Schwierigkeit aufgezeigt wurde, soll nun die Frage geklärt werden, unter welchen Umständen Leid gerechtfertigt bzw. ungerechtfertigt ist – wobei gerechtfertigtes Leid mit der Güte Gottes vereinbar und ungerechtfertigtes Leid mit der göttlichen Güte unvereinbar ist.
Angenommen, ein Chirurg ist mit der Frage konfrontiert, ob er an einem Patienten eine Operation vornehmen solle oder nicht. Wann ist die Operation, also die Schaffung von Leid gerechtfertigt?
Antwort: Die Operation ist dann gerechtfertigt, wenn zumindest die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a. Die Operation wird – bei bestem Wissen – zu einem Gut führen, wobei dieses Gut das Leid, das durch die Operation verursacht wird, bei weitem überwiegt – wenn also die Schmerzen der Operation verglichen mit den zu erwartenden Freuden (der Gesundheit) gering sind.
b. Das Gut, also die Verbesserung des Gesundheitszustandes kann auf keine andere Weise, etwa durch harmlose Medikamente oder durch eine Physiotherapie, erreicht werden.
Ein Chirurg ist also berechtigt, eine Operation vorzunehmen, wenn diese mit großer Wahrscheinlichkeit die Lebensqualität des Patienten wesentlich verbessern wird und dieses Ziel auf keine andere, weniger leidvolle Weise erreicht werden kann.
Dasjenige Kriterium, welches erlaubt, gerechtfertigtes von ungerechtfertigtem Leid zu unterscheiden, lautet somit: Ein bestimmtes Leid ist dann gerechtfertigt, wenn es bei bestem Wissen zu einem Gut führt, das nur auf diese Weise erlangt werden kann, wobei das Gut proportional wesentlich größer ist als das Leid. Diesem Kriterium zufolge ist, um ein weiteres Beispiel zu nennen, ein Feuerwehrmann berechtigt, jemandem einen schmerzhaften Stoß zu versetzen, wenn er ihn allein dadurch vor einem herabfallenden Balken retten kann.
Nun scheint es in dieser Welt sowohl gerechtfertigtes als auch ungerechtfertigtes Leid zu geben. Ungerechtfertigt ist Leid dann – um das nochmals zu wiederholen -, wenn es zu keinem höheren Gut führt oder wenn dieses Gut auf andere, nämlich schmerzlosere Weise erlangt werden kann.
Übel sei im Folgenden jenes Leid genannt, das nicht gerechtfertigt ist („Leid“ und „Übel“ sind also im Folgenden keine synonymen Begriffe!). Zwar erleben die allermeisten Leid als negativ, aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, so meinen Theisten, dass ihm auch eine positive Funktion zukommt, da es unerlässlich ist zum Erlangen eines hohen Gutes. Für viele Formen von Leid scheint dies jedoch nicht zu gelten.
Diese Übel sind die eigentliche Herausforderung für Theisten, da sie der Annahme eines gütigen und weisen Gottes widersprechen.
5. Lösungsversuche des Theodizee-Problems
Die fundamentale Erfahrung, dass es in dieser Welt ungerechtfertigtes Leid gibt, wird von Theisten zu zerstreuen versucht, indem sie zeigen, dass auch die zunächst als Übel geltenden Leiden in Wahrheit gerechtfertigt sind, da auch sie zur Verwirklichung eines höheren Gutes dienen. Konkret lassen sich nun innerhalb der klassischen Theodizeen zwei Gruppen von Lösungsversuchen unterscheiden:
Entweder wird durch Zusatzannahmen, die im Hinblick auf die zur Diskussion stehende Vereinbarkeit der Prämissen I‑IV so etwas wie eine „Brückenfunktion“ haben, deren Vereinbarkeit zu erweisen gesucht; oder es wird durch Interpretation bzw. Modifikation der Prämissen II-IV das Problem zu „umgehen“ versucht.
Ein Beispiel der zweiten Art ist die Privationslehre, der zufolge es überhaupt nichts wirklich Negatives, sondern nur einen Mangel an Gutem gibt. Und ein Beispiel der ersten Art ist die Annahme, dass die Welt trotz allen Leids insgesamt gesehen eine gute, ja die bestmögliche ist, da alles Leid im Wege des Kontrastes zur Verwirklichung des Kunstwerks Erde diene.
5.1. Brückenannahmen
Zunächst zu den Brückenannahmen: Meines Wissens wurden in der Geschichte des Theodizee-Problems folgende Brückenannahmen (sowie Kombinationen dieser) zur Rechtfertigung von Leid und damit zur Rechtfertigung der Güte und Gerechtigkeit Gottes erdacht.
5.1.A Geordnetes Universum
Näher ausgeführt, lautet die Brückenannahme A so: Gott schuf die bestmögliche Welt, was sich an der Geordnetheit des Universums zeigt. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür sind die Gravitationskräfte, denn ohne sie bräche das reine Chaos aus: Die Erde beispielsweise, sollte sie sich noch um ihre Achse drehen, würde aufgrund zentrifugaler Kräfte in ihre Bestandteile zerrissen. Dort, wo einmal Leben herrschte, gäbe es nur noch einen Nebel planlos dahintreibenden Staubs.
Aber diese Ordnung hat einen Preis, den auch Gott entrichten musste. Denn jene Kräfte, die für diese Geordnetheit verantwortlich sind, zeitigen manchmal, etwa bei Flut- oder Flugzeugkatastrophen, negative Konsequenzen. Wenn aber Menschen selbst beurteilen sollen, welche Folgen ihr Tun oder Unterlassen nach sich ziehen, dann müssen die Naturgesetze als feste Regeln gelten. Nur in einer geordneten Welt können wir eingreifen, können Lebenspläne entwickeln und Veränderungen vornehmen, also Freiheit üben. Das heißt dann aber auch, dass es „Opfer des Systems“ geben wird.
Diskussion. Natürlich ist die Brückenannahme A grundsätzlich geeignet, das Theodizee-Problem zu lösen, weckt allerdings – so meinen Skeptiker – fundamentale Zweifel.
So ist nicht einzusehen, warum Gott keine bessere Weltordnung schuf, etwa eine solche, in der es keine Wucherung von Zellen, also keinen Krebs gibt. Für den Allmächtigen, den Schöpfer von Milliarden Milliarden Sonnensystemen, kann es kein Problem sein, diese Möglichkeit zu realisieren. Eine andere bessere Welt wäre eine solche, in der es keine Evolution, also kein Fressen und Gefressenwerden über hunderte von Millionen Jahre gibt. Gott hätte den Menschen, wie es auch in der Bibel heißt (Gen 2,7), einfach aus einem Klumpen Erde, dem er Leben einhauchte schaffen können. Die Behauptung, dass diese unsere Welt mit Evolution die bestmögliche sei, lässt sich also mit dem Hinweis auf Geordnetheit nicht begründen.
Aber selbst dann, wenn die gegebene Ordnung bestmöglich wäre, könnte Gott bei dennoch auftretenden großen Übeln durch Wunder, also durch ein Durchbrechen der Naturgesetze eingreifen. Droht beispielsweise eine Kontinentalplatte mit einer anderen zu kollidieren, so könnte der Allmächtige durch einen kleinen Fingerzeig den Zusammenstoß und damit Erdbeben und Tsunamis verhindern. Da er die Macht dazu besäße, es aber nicht tut, ist Seine Güte nicht gezeigt.
Die Brückenannahme A erfüllt also, so die Kritik, die in sie gesetzte Hoffnung auf eine Lösung des Theodizee-Problems nicht.
5.1.B Göttliches Kunstwerk
Bei diesem Lösungsversuch wird nicht, wie im vorangegangenen, aus der Regelmäßigkeit, sondern aus der Mannigfaltigkeit der Dinge auf die Güte Gottes geschlossen. Von diesem Lösungsversuch existieren zwei Varianten:
a. Alles Leid als notwendiger Kontrast.
In der ersten Version der Brückenannahme B wird die Fülle an Leid mit dem Hinweis gerechtfertigt, dass es im Wege des Kontrasts einen notwendigen Beitrag zu einem optimalen Gesamtbild leiste. So, wie Gegensätze die Rede verschönern, schafft die göttliche Kunst, die sich der Dinge statt der Worte bedient, durch ähnliche Antithesen die Schönheit des Ganzen. Leiden und Laster sind also Dissonanzen im gerade dadurch umso großartiger klingenden carmen universitatis, „Lied des Universums“ – so könnte diese Version der Brückenthese B kurz zusammengefasst werden.
Diskussion. Interessanterweise ist die logische Struktur dieses Gedankengangs mit demjenigen der Brückenannahme A nicht identisch. Zwar wird in beiden Fällen behauptet, dass es unmöglich sei, dass eine bestimmte Eigenschaft (Ordnung bzw. Schönheit) ohne Leid gegeben sein könnte; auch wird in gleicher Weise betont, dass Leid nicht isoliert betrachtet werden dürfe, sondern im Gesamtzusammenhang gesehen werden müsse.
Aber ein fundamentaler Unterschied besteht doch: Während in der Brückenannahme A alles Leid als eine unerwünschte, wiewohl unvermeidliche Konsequenz von Ordnung behauptet wird, gilt in der Brückenannahme B, dass alles Leid als ein von Gott bewusst eingesetztes Mittel zur Verwirklichung eines überragenden Gutes, nämlich der Schönheit des Ganzen, zu verstehen sei. Die Leiden und Schrecken der Welt erfüllen als Mittel zu einem hervorragenden Zweck eine notwendige Funktion im bestmöglichen Gesamtbild. Dies gilt nach Leibniz auch für die damals weitverbreitete Glaubensannahme, wonach ein Großteil der Menschen sich am Ende der Tage im ewigen Höllenfeuer wiederfinden werde. Die vielen Verdammten der Erde haben also die Funktion eines dissonanten Akkords im Rahmen der gerade dadurch umso eindrucksvoller klingenden göttlichen Weltsinfonie.
b. Leid als notwendiger Gegensatz.
Von der Brückenannahme B existiert noch eine abgeschwächte Version, die im Gegensatz zur stärkeren nicht nur vor allem von Philosophen, sondern auch von Theisten und Predigern vertreten wird. Sie lautet so:
Gott schuf die bestmögliche Welt. Aber eine Welt ohne Leid ist schlechter als die tatsächlich von Gott geschaffene, denn Leid ist ein notwendiger Gegensatz zum Guten. Trotz seiner Allmacht konnte auch er Dinge, die unmöglich sind, nicht schaffen, „denn beseitigte er das Schlechte, so beseitigte er auch das Gute“. Jedem Gut muss daher als Gegensatz ein Leid gegenübergestellt werden.
Diskussion. Das Problematische an der Brückenannahme B allgemein, so die skeptischen Bedenken, besteht darin, dass durch diesen Lösungsversuch bestenfalls eine kleine Menge an Leid gerechtfertigt ist. Zwar vermag der eine oder andere Kontrast, einige Schattierungen oder Moll-Töne tatsächlich zur Schönheit des Kunstwerks beitragen. Aber alle Leiden dieser Welt tragen zur ästhetischen Vollkommenheit mitnichten bei.
Ähnliches gilt für die schwächere Version dieses Brückenprinzips. Einige Leiden (Zahnschmerzen, Langeweile etc.) mögen uns das Gute, über das wir auch verfügen, tatsächlich intensiver erleben lassen. Aber alle Leiden dieser Welt zusammengenommen, lassen uns nichts Gutes mehr empfinden. Die zweifellos auch vorhandenen positiven Seiten des Lebens ersticken dann im Sumpf von Schmerz und Elend. Zum Glück schützen uns unsere Verdrängungsmechanismen vor einem Bewusstwerden allzu vielen Leids.
Zudem gilt als Einwand gegen die Behauptung, dass erst Negatives Positives erfahrbar macht: Irgendwann hatte jeder von uns eine erste Empfindung. Diese mag angenehm oder unangenehm gewesen sein. Da ihr keine andere Erfahrung vorausgegangen ist, vermögen wir offensichtlich Angenehmes und Unangenehmes sehr wohl als solches zu erleben. Daher ist nicht einzusehen, warum Gott, der Schöpfer des Universums, nicht imstande sein sollte, Geschöpfe zu kreieren, die noch viel intensiver und unmittelbarer Gutes – ohne den Umweg über negativ Erlebtes – als angenehm empfinden.
Und schließlich: Bei einer Theodizee geht es nicht darum, Gott als vollkommenen Künstler zu rechtfertigen, sondern als den Gütigen und Gerechten; das Religiöse dreht sich also primär nicht um ästhetische, sondern um ethische Werte.
5.1.C Sittliche Weltordnung
Dieser Lösungsversuch handelt von Moralität und die Pädagogisierung von Leid und lautet so: Gott schuf die bestmögliche Welt, so wird behauptet, was an der Tatsache offenbar wird, dass es unter Menschen ethisches Verhalten gibt. Ein solches setzt jedoch Leid voraus, das uns zwar zunächst als Übel erscheinen mag, das aber in Wirklichkeit gerechtfertigt ist, da eine notwendige Voraussetzung ethischen Verhaltens. Eine Welt mit menschlicher Moralität ist ungleich besser als eine solche ohne sie.
Diskussion. Alles Leid erfüllt laut dieses Lösungsversuches eine wichtige Funktion, dient es doch der sittlichen Besserung der Menschen, etwa der Ausbildung moralischer Tugenden wie Solidarität, Mitgefühl, Tapferkeit oder Pflichtgefühl. Damit jemand verzeihen, sich als mutig erweisen, Mitleid üben oder einer Versuchung widerstehen kann, muss es Leid oder zumindest Unbehagen unterschiedlicher Art geben. Daher war Gott berechtigt, zur Verwirklichung moralischer Güter Leid zu schaffen.
Kritiker dieser Überlegung können Folgendes einwenden: Zwar mag negativ Erlebtes nicht selten zu Mitgefühl, größerer Reife und Humanisierung führen, manchmal sogar zu einem Drang, die Welt ein klein wenig verbessern zu wollen. Aber zumeist hängt dieser positive Effekt von der Größe und Fülle des Leids ab.
Für den Zusammenbruch ganzer Regelsysteme, für Tod und Vernichtung Unzähliger etwa bei einer Naturkatastrophe oder einem Genozid – für das Grauen der Geschichte allgemein – gilt dies keinesfalls. Solche natürlichen oder moralischen Katastrophen als notwendige Mittel zu einem guten Zweck zu interpretieren, wirkt wie blanker Zynismus. Denn viele Menschen können ob der Quantität von Leid, das sie unmittelbar oder mittelbar erfahren, kein Mitleid mehr empfinden. Sie sind emotional überfordert, werden verbittert und verhärmt und depressiv. Wegen der Leiden, mit denen Menschen konfrontiert sind, verspüren viele keinen Drang mehr, die Umstände zu verbessern, sondern sie wollen – oft unbewusst – zerstören, was ihnen auch allzu oft gelingt.
Nicht übergroßes Leid, sondern Verständnis, Zuneigung, Vertrauen und Geborgenheit – so könnte der skeptische Einwand noch ausgeführt werden – sind der Nährboden von Sittlichkeit und des Wunsches, konkrete Situationen und damit die Welt ein wenig besser zu machen. Weil dem in den meisten Fällen so ist, hätte Gott allen Grund, die Leiden der Welt zu vermindern, und wäre er gütig, so täte er dies auch.
Zweifellos folgt manchmal aus Negativem Gutes, aber oft genug zieht Böses wieder Böses nach sich. „Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten“, heißt es so treffend. Und im AT ist zu lesen, dass derjenige, der Wind sät, einen Sturm ernten wird (Hosea 8, Vers 7).
Aber nicht nur folgt aus dem Negativen oftmals Negatives, also nichts Gutes. Der Lösungsversuch C des Theodizee-Problems mit dem Hinweis auf eine sittliche Ordnung ist noch aus einem weiteren Grund wenig überzeugend: Dass Mitgefühl und Solidarität in einer Welt des Leids große Güter sind, ist unbestritten. Aber die Frage stellt sich, warum Gott – angeblich gütig und gerecht – eine Welt mit so großem Leid geschaffen hat. Er verfügte ja auch über andere Möglichkeiten und hätte beispielsweise sogleich paradiesische, also leidfreie Zustände schaffen können. In einer solchen wären Mitgefühl und Solidarität keine überragenden Güter mehr, aber anstatt sich um Krankheiten und Ungerechtigkeiten verschiedenster Art kümmern zu müssen, könnten Menschen sich viel stärker der Kunst oder Wissenschaft widmen.
Also nicht nur die Behauptung, dass aus Negativem stets Positives folgt, ist problematisch, auch die Annahme ist es, dass etwa Mitgefühl und Solidarität an sich große Güter wären. Somit gilt auch für diese Brückenannahme, dass die im Hintergrund stehende theistische Behauptung, dass Gott die bestmögliche Welt schuf, nicht haltbar ist.
5.1.D Menschliche Freiheit
Der Verweis auf menschliche Freiheit ist wohl der berühmteste Lösungsversuch des Theodizee-Problems und lautet so:
Gott schuf die bestmögliche Welt, was sich daran zeigt, dass es menschliche Freiheit gibt. Eine Welt mit einer solchen ist ungleich besser als eine Welt ohne sie. Der Preis der Freiheit ist allerdings, dass sie auch missbraucht werden kann, dann nämlich, wenn Menschen sich für das Falsche und Böse entscheiden. Dies haben sie getan (und tun es weiterhin), wodurch alles Leid in die Welt kam bzw. kommt. Zwar erscheinen uns die vielen Leiden zurecht als Übel, aber da sie nur Folge des Missbrauchs der Freiheit sind, ist Gott nicht dafür verantwortlich zu machen. Uns Menschen trifft die ganze Schuld, der Schöpfer ist ohne Fehl und Tadel.
Diskussion: Obwohl so berühmt und weitverbreitet, weckt auch dieser Lösungsversuch, so meinen zumindest Skeptiker, fundamentale Zweifel. Wiederum geht es darum, dass der Allmächtige etwas Vollkommeneres hätte schaffen können, konkret: Die Natur des Menschen sowie die äußeren Umstände, in denen wir leben (müssen), könnten besser sein. In beiden Fällen wäre als Folge davon der Missbrauch der Freiheit seltener geschehen, die Menge sinnlosen Leids somit geringer.
Beispielsweise hätte der Allmächtige den Menschen mit stärkeren altruistischen Motiven und ohne den seltsamen Wunsch, wie er sein zu wollen, ausstatten können. Auch hätte Gott Menschen mit einem stärkeren Motiv, ein vernünftiges Leben führen zu wollen, kreieren können.
Und nicht nur die inneren, auch die äußeren Umstände hätte er so gestalten können, dass Menschen ihre Freiheit seltener missbrauchen. Denn viele Vergehen entstehen allein dadurch, dass Menschen als Mängelwesen sich in einer ambivalenten Umgebung behaupten müssen. Wesen mit ausgeprägteren moralischen Motiven, aber ohne Allmachtsfantasien und in eine angenehmere Umgebung gesetzt, handelten sittlicher – so, wie Wesen mit noch weniger altruistischen Antrieben und in eine noch feindlichere Umgebung gesetzt, sich wahrscheinlich noch verwerflicher verhielten.
Denken wir zur Illustration an Selbsttötung. Man könnte sich leicht eine Welt vorstellen, in der kein Mensch Selbstmord begeht – ohne dass damit die Möglichkeit zum Selbstmord, die wir alle beinahe permanent haben, aufgehoben wäre. Da viele Welten denkbar sind, die besser sind als diese, kann der Schöpfergott nicht vollkommen gut sein.
Ein weiterer fundamentaler Kritikpunkt von skeptischer Seite an dem Lösungsversuch mit dem Hinweis auf menschliche Freiheit lautet, dass Gott, wie die vielen Vernichtungslager der Geschichte erschreckend deutlich machen, auch bei massivem Ausbruch roher Gewalt nicht eingreift. Der Einwand, dass er dies deshalb nicht tut, weil er unsere Freiheit respektiert, bedeutet recht besehen, dass Gott zwar die Freiheit der Täter heilig ist, nicht aber die Freiheit der Opfer.
Einer der großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts hatte ein ausgeprägtes Interesse an Architektur und an der Musik Richard Wagners. Der angeblich Allgütige hätte – für ihn und uns unbemerkt – diese künstlerischen Interessen so verstärken können, dass sie dessen destruktiven Gelüste überlagern. Zwar wäre Hitler der Freiheit beraubt gewesen, sich für oder gegen das Böse zu entscheiden, aber millionenfaches Leid wäre der Menschheit erspart geblieben und die grundsätzliche Freiheit der Opfer wäre garantiert gewesen. Es ist nicht einzusehen, warum der himmlische Vater bei einer Hochzeit in großzügiger Weise Wasser in Wein verwandelte, aber bei Völkermord untätig bleibt. Da er dies tut, so würde ein Skeptiker schließen, ist er nicht gütig zu nennen.
Jedes menschliche Wesen, sofern es halbwegs gerecht empfinden kann oder sogar gütig ist, würde – wenn es die Macht dazu besäße und keine negativen Folgen befürchten müsste – einem Ausbruch an roher Gewalt und Zerstörung augenblicklich Einhalt gebieten. Solche Menschen, und das sind wohl die allermeisten von uns, sind offenbar keine Ebenbilder Gottes, der – sollte er denn existieren – allgegenwärtig dem wilden Treiben auf Erden zuschaut und nichts tut. Wo bleibt die angeblich „sich grenzenlos verströmende Liebe Gottes“ angesichts der Übel der Welt?
Ein gütiger Gott, so könnten Skeptiker zusammenfassend behaupten, sicherte die Freiheit der Opfer und ergriffe Partei für sie. Aber so, wie die Welt nun einmal beschaffen ist, achtet Gott viel eher die Freiheit der Täter als diejenige der Opfer. Den Diktatoren der Geschichte wird das göttliche Recht auf freien Willen garantiert, nicht so den Geschundenen.
Wenn Gott allgütig wäre, hätte er die Welt besser geschaffen, und zwar als Paradies. Dadurch wären Menschen keineswegs der Freiheit beraubt. Wird nämlich ein künftiges Reich Gottes erhofft, so wird von Theologen ausdrücklich die Möglichkeit eines Zustands eingeräumt, in dem Wesen immer freiwillig das Gute tun. Eben diese Möglichkeit setzen sie in selbstverständlicher Weise voraus, dann nämlich, wenn sie den guten Engeln wie auch den Seligen im Himmel keineswegs die Willensfreiheit absprechen, obwohl sie annehmen, dass diese de facto der Sünde nicht anheimfallen. Wenn aber ein solch paradiesischer Zustand von Wesen, die in Freiheit stets das Gute tun, Gegenstand einer vernünftigen Hoffnung sein kann, so stellt sich mit Nachdruck die Frage, warum Gott, angeblich vollkommen, nicht sogleich diese Möglichkeit ergriff und damit den Lebewesen unendlich viel Leid erspart geblieben wäre.
Mit dem vorangegangenen Lösungsversuch lässt sich die Freiheitskonzeption wie folgt vergleichen. Zunächst wird – wie üblich – in beiden Fällen behauptet, dass Gott die bestmögliche Welt geschaffen hatte. In einem zweiten Schritt wird dies anhand einer bestimmten Eigenschaft illustriert: an der Moralität von Menschen sowie an deren Freiheit. In einem dritten Schritt wird im Fall von Moralität behauptet, dass das als sinnlos erscheinende Leid zur Entwicklung sittlicher Tugenden notwendig, somit gerechtfertigt ist. In der Freiheitskonzeption hingegen wird an der Existenz sinnlosen Leids festgehalten. Diese Übel werden aber, ohne dass ihnen eine notwendige Funktion zukäme, als vereinbar mit Gottes Güte behauptet, da sie allein durch menschlichen Missbrauch der Freiheit in die Welt kamen. Gottes Güte ist somit bewahrt und gerechtfertigt, und das Theodizee-Problem, so meinen Theisten, ist gelöst.
5.2 Umgehungsversuche
Bei diesen Lösungsversuchen des Theodizee-Problems geht es nicht darum, durch Zusatzannahmen die scheinbare Unvereinbarkeit der Prämissen I‑IV zu überbrücken, sondern durch Neuinterpretation bzw. Modifikation der Prämissen II-IV das Problem zu lösen.
5.2.A Privationslehre
Dieser Lösungsversuch ist eine Modifikation bzw. Ergänzung der Prämisse IV. In Wirklichkeit, so wird behauptet, gäbe es gar kein substantielles Leid und somit auch keine Übel, sondern nur einen Mangel an Gutem. Weil dem so ist, taucht das Theodizee-Problem gar nicht auf.
Diskussion. Der Privationsbegriff des Negativen basiert auf der Annahme, dass alles Seiende in Wirklichkeit gut sei: Omne ens est bonum („Das ganze Sein ist gut“). Die angeblichen Übel der Welt seien bloß eine Beraubung, eine Unordnung, eine Störung der Harmonie, eine privatio boni (Mangel an Gutem). Da den Leiden somit kein wirkliches Sein zukommt, bedürfen sie eines Trägers: Denn wie eine Krankheit nicht allein, sondern nur an einem Körper existiert, so haftet auch das Negative am Guten. Da dies also nicht substantiell, sondern bloß akzidentell ist, ist es machtlos und kann nicht durch sich, sondern nur durch die Kraft des Guten wirken. Vordergründig mag den Leiden eine Realität zukommen, aber in Wirklichkeit steht alles zum Besten.
Der entscheidende Punkt dieser Argumentation besteht in der sachlichen Ineinssetzung des Guten mit dem Sein. Das Sein ist gut, das Böse ist ein Nichts, das Übel ist nicht-seiend. Weil das Leid nur eine negative Begleiterscheinung des geschöpflichen Seins ist, lautet die vierte Prämisse richtigerweise: Es gibt nur einen Mangel an Gutem.
Aber die gerade unter Theologen beliebte Privationslehre weckt, so der skeptische Einwand, zumindest zwei Bedenken. Zum einen wehrt sich das menschliche Empfinden gegen diese Art der Metaphysik. Denn weniger das Angenehme als vielmehr den Schmerz empfinden wir unmittelbar, was auch evolutionär durchaus sinnvoll ist. Während wir häufig umfangreich reflektieren und Vergleiche anstellen müssen, um uns bewusst zu machen, dass wir eigentlich viel Gutes erleben, bedarf es zumeist keinerlei Nachdenkens, um Negatives bewusst zu erleben.
Zudem stellt sich in Bezug auf die Privationslehre die simple Frage, weshalb es einen solchen Mangel an Gutem gibt, wenn Gott allgütig und mächtig ist.
5.2.B Der leidende Gott
Dieser Umgehungsversuch, der eine Ergänzung von Prämisse II ist, lautet so: Gott ist nicht nur der gütige Vater und gerechte Richter, sondern Er ist auch derjenige, der aus Mitgefühl Seine Geschöpfe in ihrem Leid nicht allein lässt. Gott ist somit nicht nur das summum bonum, das ens perfectissimum, sondern auch der leidende Gott, der sogar sein Leben für uns und unsere Sünden hingab. So viele Mühen gibt es in der Welt, aber Gott trägt mit uns ihre Last!
Diskussion. Natürlich ist diese Vorstellung vom „Leiden Gottes aus Liebe“ für das Christentum typisch, während sie im Judentum und Islam nicht nur fehlt, sondern häufig sogar als Gotteslästerung empfunden wird („Der Allmächtige soll sich vor zweitausend Jahren von römischen Soldaten auspeitschen haben lassen …?“).
Die Lehren von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen und, vor allem, von der Menschwerdung Gottes sind die Kernstücke der christlichen Anthropologie. Weil Gott selbst größtes Leid auf sich genommen hat, kann es nicht „Übel“ genannt werden.
Aber ist es nicht bereits problematisch, so die wohl entscheidende skeptische Frage, wie der Allgütige nur auf die Idee kommen konnte, dass Leid dasjenige ist, was Schöpfer und Geschöpf am engsten miteinander verbindet? Käme ein gütiger und weiser Gott nicht eher auf den Gedanken, dass Verständnis und, vor allem, Liebe die göttliche und menschliche Sphäre am besten überbrücken kann?
Von diesem Lösungsversuch gibt es eine Variante, bei welchem die christliche Vorstellung, dass Gott selbst schlimmste Leiden auf sich genommen hat, keine Rolle spielt. Aus diesem Grund ist diese Idee auch in anderen Versionen des Monotheismus zu finden: Gott nimmt zwar Anteil an den Mühen der Welt, schickt aber auch Leiden, um Menschen zu einem gottgefälligeren Leben zu erziehen. Leid gilt hier als ein notwendiges Mittel zum individuellen Du zwischen Schöpfer und Geschöpfen. Diese „Vergöttlichung“ des Negativen bildet die Folie für verschiedene theistische Behauptungen: „Das Leid ist die Hilfe Gottes, um die Seele aus den Händen des Feindes zu befreien“; „Das Leid beschleunigt den Weg zu Gott“; „Durch das Leid entzieht Gott der Seele den irdischen Trost und nötigt sie, himmlischen Trost zu suchen“; „Not und Leid wird den Menschen gesandt, damit sie vor Trägheit und Schlaffheit bewahrt bleiben“. Und schließlich unüberbietbar: „Not lehrt beten!“
Auch bei dieser abgeschwächten Variante dieses Umgehungsversuches stellt sich für Kritiker die Frage, warum gerade Leid, also Negatives, dasjenige sein sollte, was Schöpfer und Geschöpf miteinander verbindet. Hätte ein allgütiges und allwissendes Wesen nicht eine bessere Idee?
Irdische Eltern, die ihre Kinder lieben, werden jedenfalls andere Möglichkeiten ersinnen, um einander nahe zu sein. Wie wäre es beispielsweise mit Respekt oder einfach mit der allseitigen Bereitschaft, anderen und sich selbst genau zuzuhören?
5.2.C Göttliche und menschliche Güte
In diesem Lösungsversuch – ebenfalls eine Neudeutung der Prämisse II, wird infrage gestellt, ob das, was wir als „gütig“ und „gerecht“ verstehen, überhaupt göttlichen Vorstellungen entspricht: Natürlich ist Gott allgütig, aber seine Güte entspricht nicht der unseren. Vieles erscheint uns als negativ, als unvereinbar mit wahrer Güte und Gerechtigkeit, etwa dass Gott laut Genesis-Bericht in gänzlich unangemessener Weise Unschuldige, und zwar künftige Generationen für die Vergehen ihrer Vorfahren bestraft; oder dass er nicht eingreift, wenn Menschen, etwa durch Erdbeben oder Flutkatastrophe oder Genozid, größtes Leid zugefügt wird, kurz: dass es auf Erden eine derartige Fülle an – für uns – ungerechtfertigtem Leid gibt.
Aber, so wird nun von theistischer Seite erwidert, dies sei eben die menschliche Sicht der Dinge, und da Gottes Sicht nicht die unsere ist, ist alles das, was wir bloß als Übel begreifen, in Wirklichkeit gut. „Mag uns Vieles als ungerecht und böse und negativ erscheinen: Wer bist du Mensch, dass du richten willst den Allmächtigen?“ Gottes moralische Kategorien sind nun einmal andere.
Und nicht nur Gottes Güte ist mit menschlichen Kategorien nicht zu begreifen, sondern auch seine Gedanken und Wege sind andere. Was wir von der Welt kennen, ist beinahe nichts; und da wollen Skeptiker seine Weisheit und Güte an menschlichen Erfahrungen messen?
Diskussion. In diesem weitverbreiteten Lösungsversuch, so argumentieren Skeptiker, wird schwarz weiß und böse gut genannt. Aber allgütig heißt doch nicht „böse“, sondern „übergütig“. Ein Kreis, einmal unvollkommen gezeichnet und einmal vollkommen, bleibt ein Kreis und wird nicht durch Vollkommenheit zum Würfel. Wenn Gott nicht in unserem Sinn gut ist, wie könnte man ihn dann vom fürchterlichsten Dämon unterscheiden, der ja auch von sich behaupten könnte, die eigene Moral sei nicht-menschlich? Die Abwehr vom Dämonenglauben ist jedoch ein Leitmotiv des Alten und Neuen Testaments.
Kann nicht gezeigt werden, so die Kritik weiter, dass Gott in unserem Sinn gütig und gerecht ist, dann sollte man ihn auch nicht gut und gerecht nennen. Denn ein solches Vorgehen ist ein Missbrauch unserer innersten moralischen Intuitionen, unseres ethischen Kompasses. Falls man über göttliche Eigenschaften so sprechen soll, dass sie jenseits menschlichen Verstehens sind, dann kann man genauso gut behaupten, dass Gott böse und sadistisch ist, aber seine Bösartigkeit und Sein Sadismus sich unserem begrenzten Verstehen entziehen. Auf diese Weise öffnen wir aber der größten Heuchelei Tür und Tor.
Lässt sich nicht zeigen, dass Gott in unserem Sinn gütig und gerecht ist, dann kann er auch kein Garant für ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits sein, wie wir sie verstehen: dass es den Guten und Gerechten und Beladenen endlich besser, und den Schlechten und Menschenmonstern nicht mehr so gut geht. Ist aber Gottes Güte und Gerechtigkeit gar nicht in unserem Sinn zu verstehen, dann ist es durchaus möglich, dass die Guten im Jenseits bestraft, also in die Hölle geworfen, und die Schlimmen für ihr menschenverachtendes Tun auch noch belohnt werden, wie dies im Diesseits oftmals der Fall zu sein scheint – also keine ausgleichende Gerechtigkeit dort, sondern die gleiche Ungerechtigkeit wie hier.
Die Vorstellung von einer jenseitigen ausgleichenden Gerechtigkeit basiert auf der Annahme, dass das Höchste Wesen Ungerechtigkeiten so empfindet wie wir. Vor einem Gott, der anderen moralischen Maßstäben als den unseren anhängt, sollten wir uns durchaus fürchten. Wenn Gott keiner für uns nachvollziehbaren Moral verpflichtet ist, seine Urteile für uns tatsächlich unergründlich sind, dann tauschen Gläubige die Angst vor dem Tod gegen einen berechtigten Schrecken vor der Ungewissheit, die sie erwarten könnte, und das gleich für immer und ewig.
Gottes Macht wird stets auf eine Weise interpretiert, die für uns völlig nachvollziehbar ist: Während wir Menschen nur begrenzt imstande sind, das zu tun, was wir tun wollen, kann Gott grundsätzlich alles machen, was ihm beliebt. Gottes Ratschlüsse werden indes oft als unerforschlich bezeichnet – wohl deshalb, weil so viele Manifestationen seines Tuns bzw. Nicht-Tuns in krassem Widerspruch zu all dem stehen, was Menschen als gut und gerecht empfinden. Eine Handlung ist auf jeden Fall gut, wenn sie dem Wohlwollen entspringt und dem Gemeinwohl dient. Gottes Nicht-Tun angesichts natürlicher und moralischer Katastrophen entspringt nach skeptischem Verständnis nicht dem Wohlwollen und es dient schon gar nicht dem Gemeinwohl.
5.2.D Jenseitige Gerechtigkeit
Dieser Umgehungsversuch ist eine Modifikation von Prämisse III und lautet kurz gefasst so: Gewiss würde etwas, das selbst gut ist, etwas anderes, das schlecht oder übel ist, nach Möglichkeit beseitigen. Aber warum bereits im Diesseits?
Immer wieder taucht im Zusammenhang der Theodizee-Problematik die Frage auf, weshalb Gott, falls er allgütig ist, nicht eingreift, wenn beispielsweise eine Naturkatastrophe sich ereignet oder Menschen völlig in die Irre gehen, etwa bei Völker- oder Massenmord. Speziell auf diese brennende Frage versuchen Theisten eine überzeugende Antwort zu geben, nämlich: Etwas, das selbst gut ist, beseitigte natürlich das Schlechte, aber nicht notwendigerweise sogleich, sondern erst im Jenseits.
Diskussion: Unser moralisches Empfinden nimmt besonderen Anstoß an der Ungerechtigkeit des Weltenlaufs. Aber, so heißt es nun von theistischer Seite, der Allmächtige lässt zwar die irdische Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen, aber einmal wird er die Spreu vom Weizen trennen! Mögen auch Menschen die Rolle, die sie im Weltdrama spielen, oftmals als bedrückend erleben, so wird es doch eine Erlösung für die unsterblichen Seelen geben: am Ende aller Zeiten!
Das Problematische an diesem Lösungsversuch besteht darin, dass er im Begründungsversuch einen gütigen Gott bereits als begründet voraussetzt. Denn nur dann, wenn es einen solchen gibt, macht dieser Lösungsversuch – ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits – einen nachvollziehbaren Sinn. Aber das bedeutet nichts anderen als eine petitio principii: Das erst noch zu Begründende – nämlich die Güte Gottes – wird im Begründungsversuch bereits als begründet vorausgesetzt.
Und abgesehen davon: Warum sollte Gott im Jenseits gerecht sein, wenn er es im Diesseits nicht ist? Wenn wir eine Kiste Äpfel erhalten und die ersten Lagen verdorben sind, dann ist es wohl vernünftiger zu schließen, dass alle Äpfel verdorben sind als zu sagen: Weil die ersten Lagen zum Himmel stinken, werden die letzten vorzüglich sein!
6. Die Unlösbarkeit des Theodizee-Problems
Meines Wissens sind das die wichtigsten und ernsthaftesten Versuche, das Theodizee-Problem zu lösen. Immer wieder werden vor diesem Hintergrund Argumente vorgebracht, die zur Beantwortung der Frage, warum Gott so viel Leid zulasse, beitragen sollen.
Meines Erachtens vermögen keine der vielen derartigen Bemühungen zu überzeugen. Stets scheinen Skeptiker mit ihren kritischen Einwänden über bessere Argumente zu verfügen. Sowohl die Brückenannahmen als auch die Umgehungsversuche erweisen sich bei genauerer Betrachtung als eher löchrige Behälter, die ihren Zweck, nämlich „das Wasser des Lebens“ zu holen, nicht erfüllen können.
Aber nachdem in den Diskussionen entscheidende Kritikpunkte aufgelistet wurden, gehen wir einmal von dem für Theisten bestmöglichen Fall aus, nämlich davon, dass einer der vielen Lösungsversuche oder sogar alle gelingen. Dann wäre in der Tat gezeigt, dass alle Leiden der Welt gerechtfertigt sind oder aber allein durch Menschenhand, also ohne Gottes Zutun, verursacht sind.
Aber damit wäre die Güte Gottes immer noch nicht gezeigt, und zwar aus folgendem Grund:
Selbst wenn alle Leiden der Welt einem höheren Zweck dienten, so ist nicht einzusehen, wie ein gütiger Gott auf die Idee kommen konnte, eine derart leidvolle Welt aus dem Nichts zu erschaffen. Käme ein gütiges und barmherziges Wesen je auf die Idee, eine Welt zu kreieren, in der beispielsweise Folter gerechtfertigt ist?
Aus der Rechtfertigung allen Leids folgt also immer noch nicht die Rechtfertigung der Güte Gottes. Alles Leid zu rechtfertigen, ist zwar eine notwendige, aber offensichtlich keine hinreichende Bedingung, um Gottes Güte zu beweisen.
Aber gehen wir ein weiteres Mal von dem für Theisten bestmöglichen Fall aus, dass es nämlich doch irgendwie gelänge, Gottes Güte und Gerechtigkeit in überzeugender Weise zu begründen. Dann wäre allerdings nur gezeigt, dass die positiven Eigenschaften Gottes mit der Wirklichkeit verträglich sind. Es wäre jedoch noch nicht erwiesen, dass ein solcher Gott auch existiert. Zu zeigen, dass dem Komplex an Eigenschaften namens Gott auch die Eigenschaft der Existenz zukommt, ist das Thema von Gottesbeweisen.
Literatur
Zur Theodizee-Problematik gibt es eine Riesenfülle an Arbeiten. In der folgenden Literaturliste kann daher nur eine kleine Auswahl berücksichtigt werden, wobei sowohl theistische als auch religionskritische Arbeiten ihren Platz finden. Die ersteren betonen zumindest die Teillösung des Theodizee-Problems, die letzteren verweisen auf dessen Unlösbarkeit. Die genannten Schriften zeichnen sich zudem durch reiche Literaturangaben aus.
- Beckerman, A.: Glaube. Berlin 2013.
- Grün, A.: Womit habe ich das verdient? Die unverständliche Gerechtigkeit Gottes. München 2012.
- Hoerster, N.: Der gütige Gott und das Übel. München 2017.
- Hume. D.: Dialoge über natürliche Religion. Stuttgart 1981.
- Jonas, H.: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme. Frankfurt 1987.
- Kreiner, A.: Gott im Leid. Zur Stichhaltigkeit der Theodizee-Argumente. Freiburg 2005 (2. Aufl.).
- —: Gott und das Leid. Paderborn 2005 (5. Aufl.).
- Kant, I.: Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee, in: Kants Populäre Schriften. Berlin 2018.
- Küng. H.: Credo. München 1992.
- Leibniz, G.W.: Theodizee. Viele Ausgaben.
- Lewis, C.S.: Über den Schmerz. Gießen 2012.
- Mackie, J.L.: Das Wunder des Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Gottes. Stuttgart 1985.
- Russell, B.: Warum ich kein Christ bin. Reinbek 1968.
- Storch, K. v.: Theodizee. Paderborn 2024 (3. Auflage).
- Streminger, G.: Gottes Güte und die Übel der Welt Das Theodizee-Problem. Tübingen 2016 (2. Auflage).
- —: Die Welt gerät ins Wanken. Das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 und seine Nachwirkungen auf das europäische Geistesleben. Ein literarischer Essay. Aschaffenburg 2021.
- Swinburne, R.: Die Existenz Gottes. Stuttgart 1987.