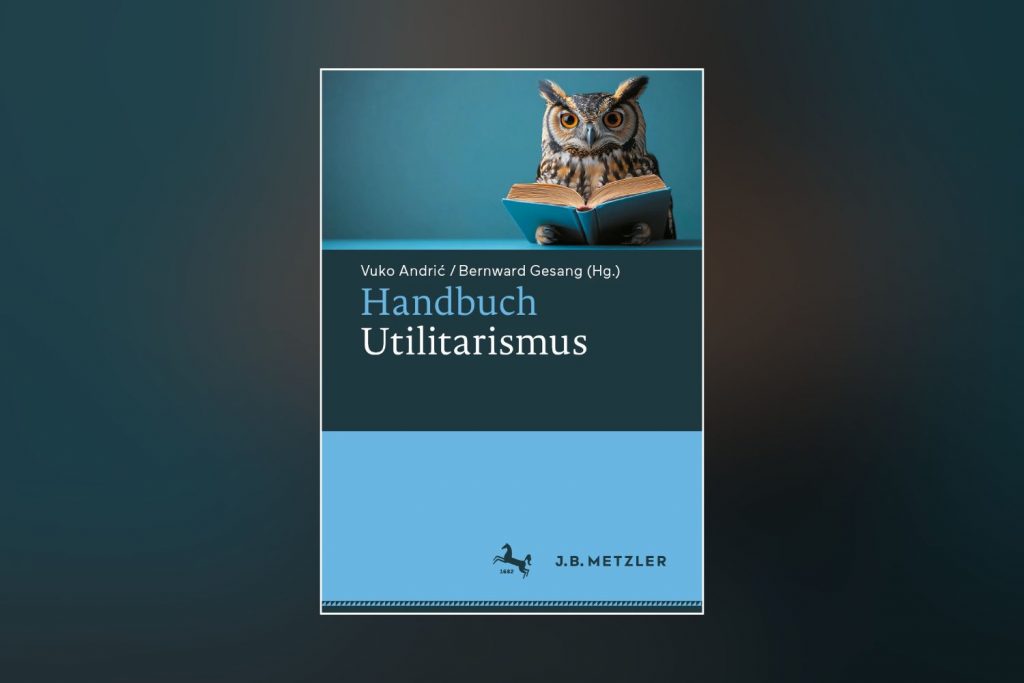Nachdem er zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn zunächst noch gemeinsam mit Karl Popper geforscht und dessen Werk zur Open Society übersetzt hatte, kehrte sich Feyerabend vom Kritischen Rationalismus ab und entwickelte einen “erkenntnistheoretischen Anarchismus”. Insbesondere sein Hauptwerk “Against Method” (1975) mit dem berühmten Credo “Anything goes!” brachte Feyerabend den Ruf ein, das “Enfant terrible” der Wissenschaftsphilosophie zu sein. Im Rationalismus sah Feyerabend das Risiko einer Einengung der Wissenschaft, und in der Wissenschaft die Gefahr einer Einengung der liberalen Gesellschaft. Hinter Feyerabends oftmals provozierend und polemisch formulierten Thesen verstecken sich jedoch feinsinnige Argumente und Analysen, wie die Beiträge des Symposiums zeigten. Die Konferenz deckte dabei ein weites inhaltliches Spektrum ab: Von der Forschung bislang kaum untersuchte philologische Details der Editionsgeschichte von Feyerabends Werken wurden ebenso thematisiert wie der Einfluss Feyerabends auf aktuelle Debatten, etwa zu Gedankenexperimenten als Erkenntniswerkzeug, zu Theorien von Gesundheit und Krankheit oder zur Frage, wie pluralistisch Erkenntnistheorie sein kann, ohne in Beliebigkeit zu entgleiten. Des Weiteren ging es um die Einordnung Feyerabends im Verhältnis zu anderen bedeutenden Wissenschaftsphilosophen seiner Zeit wie Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos oder Hans Albert.
HAI-Direktor Jonas Pöld präsentierte in einem gemeinsam mit HAI-Direktor Florian Chefai entwickelten Vortrag das Verhältnis von Albert und Feyerabend, die Freunde, Kollegen und gegenseitige Kritiker waren, wie sich u.a. ihrem Briefwechsel entnehmen lässt. Im Zentrum des Vortrags standen die sehr unterschiedlichen Auffassungen der beiden Wissenschaftsphilosophen zum Kritischen Rationalismus und zu den Funktionen der Wissenschaft in einer demokratischen Gesellschaft.
Das Symposium ergab ein Gesamtbild Paul Feyerabends als Philosophen, der neben seiner Fähigkeit, Schwachstellen in Argumenten zu erkennen, gerade durch die oft übersehene Ambivalenz seines Denkens für die Wissenschaftsphilosophie ungebrochen relevant ist. Der Anlass zu weiterführenden historischen und systematischen Deutungen seines Werks bleibt somit nach wie vor gegeben.
Das Hans-Albert-Institut dankt Bojan Borstner, Tadej Todorović und Borut Trpin für Ihre Gastfreundschaft und die hervorragende Organisation der Konferenz.